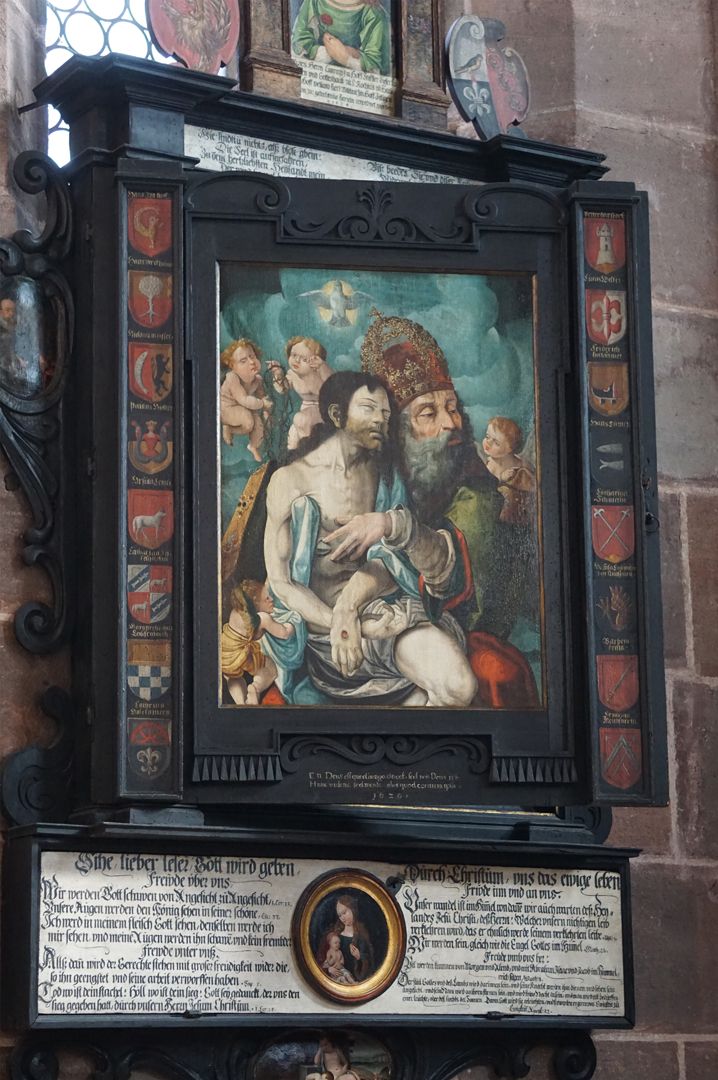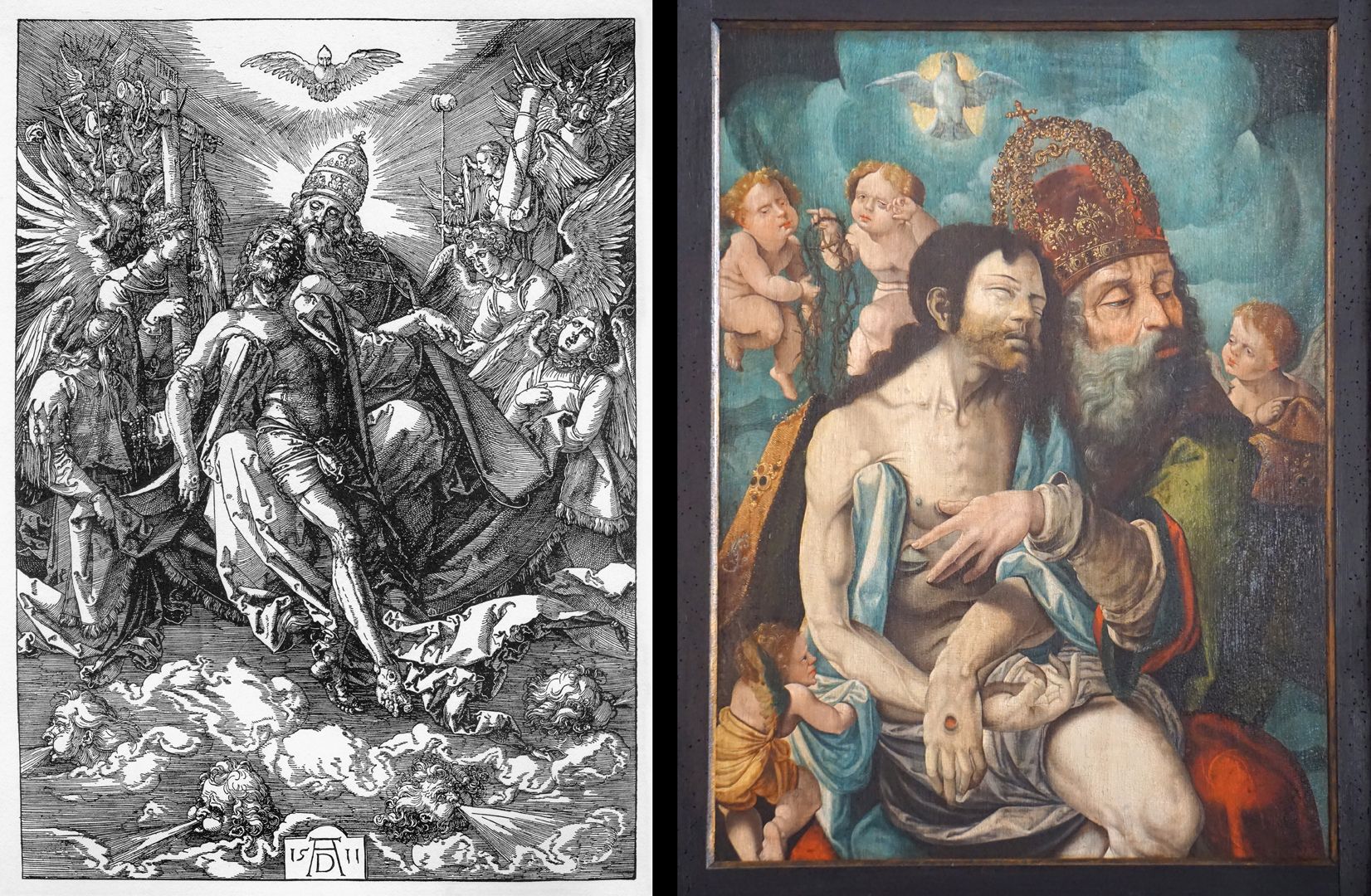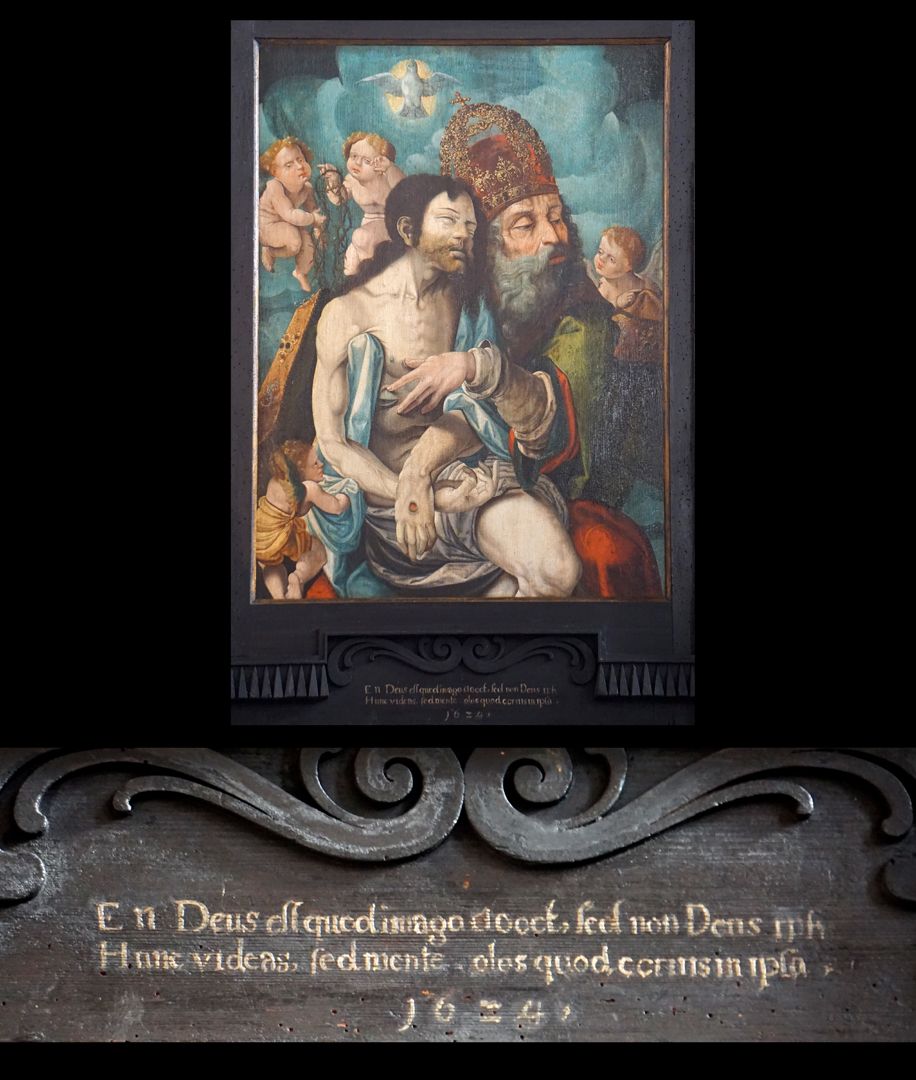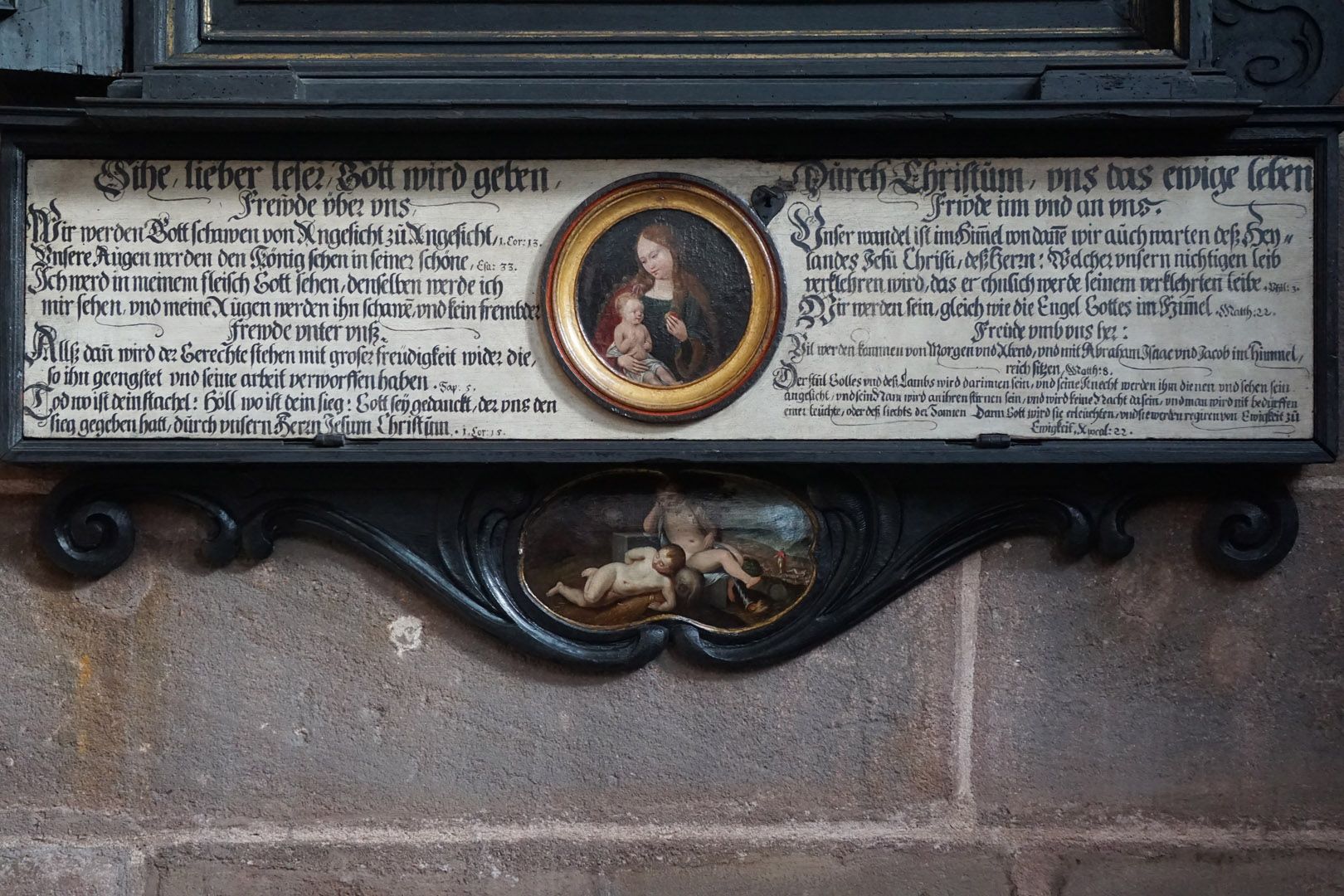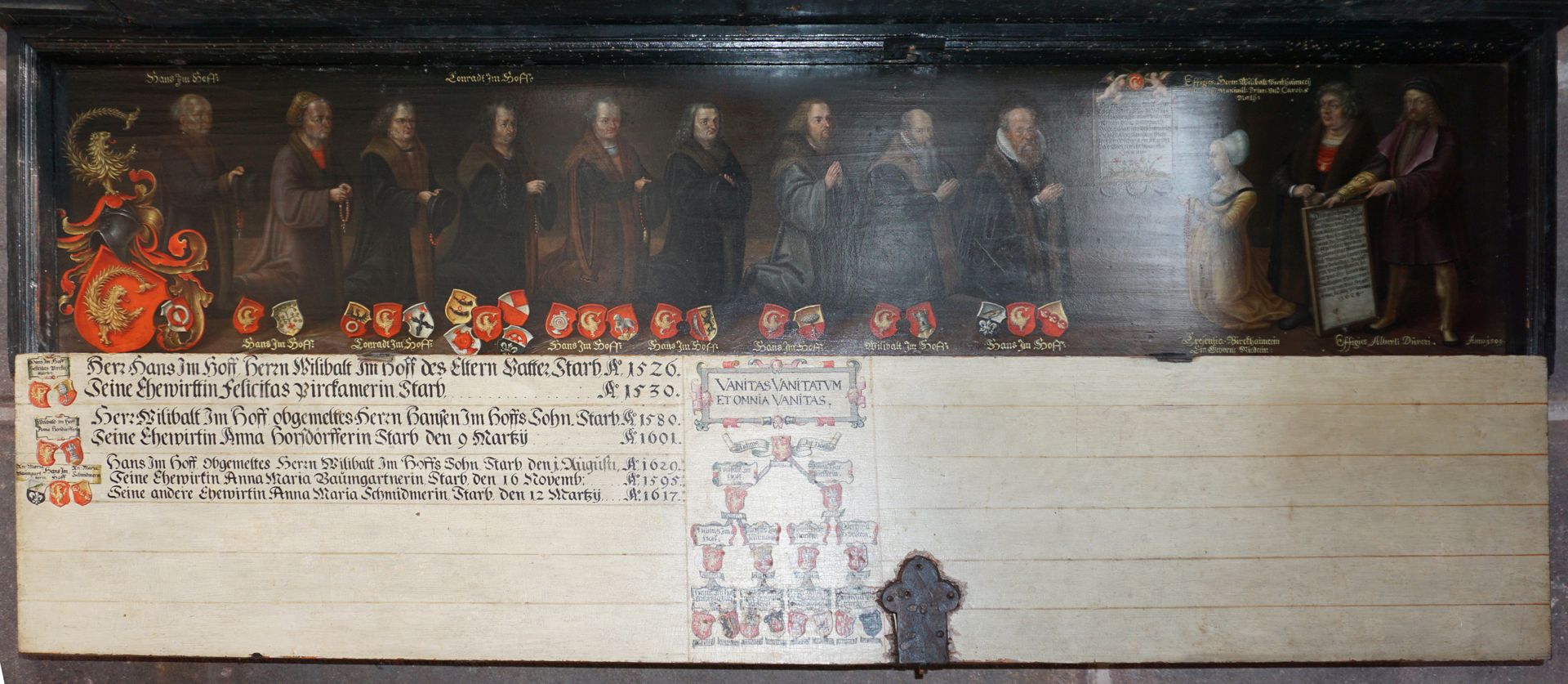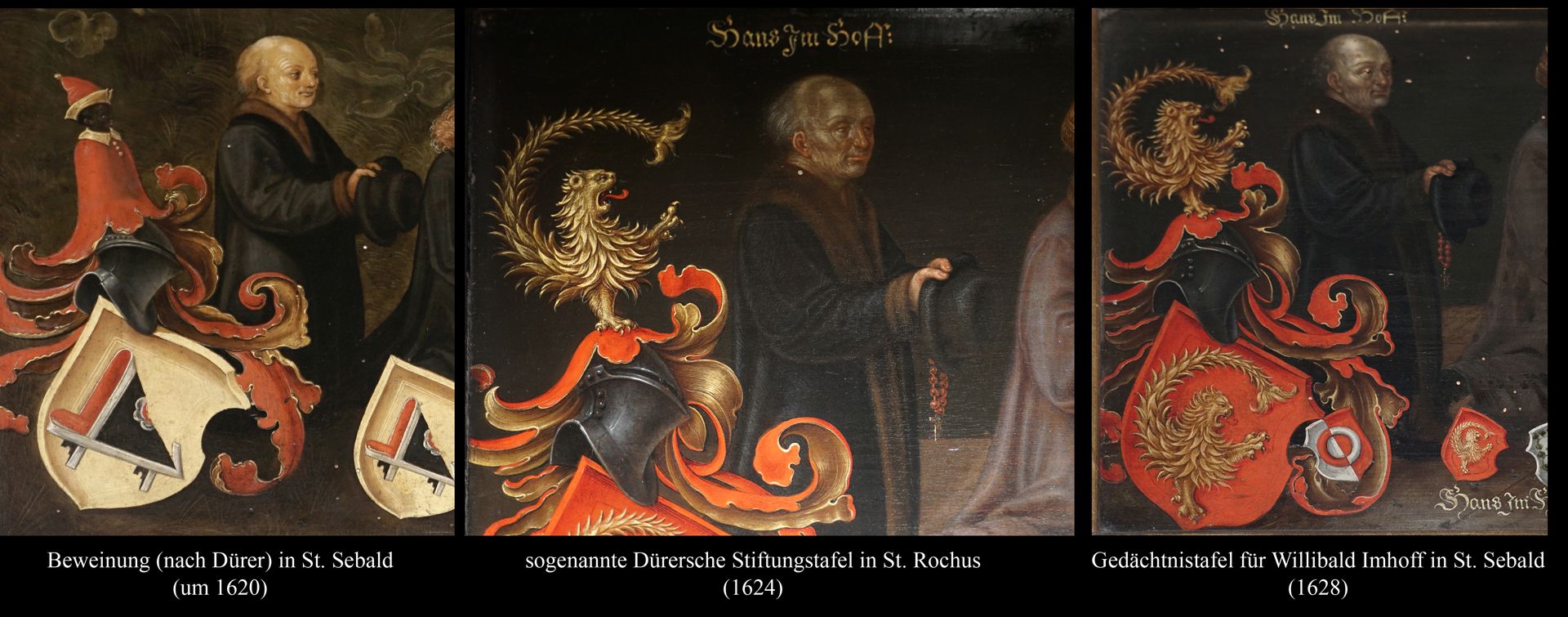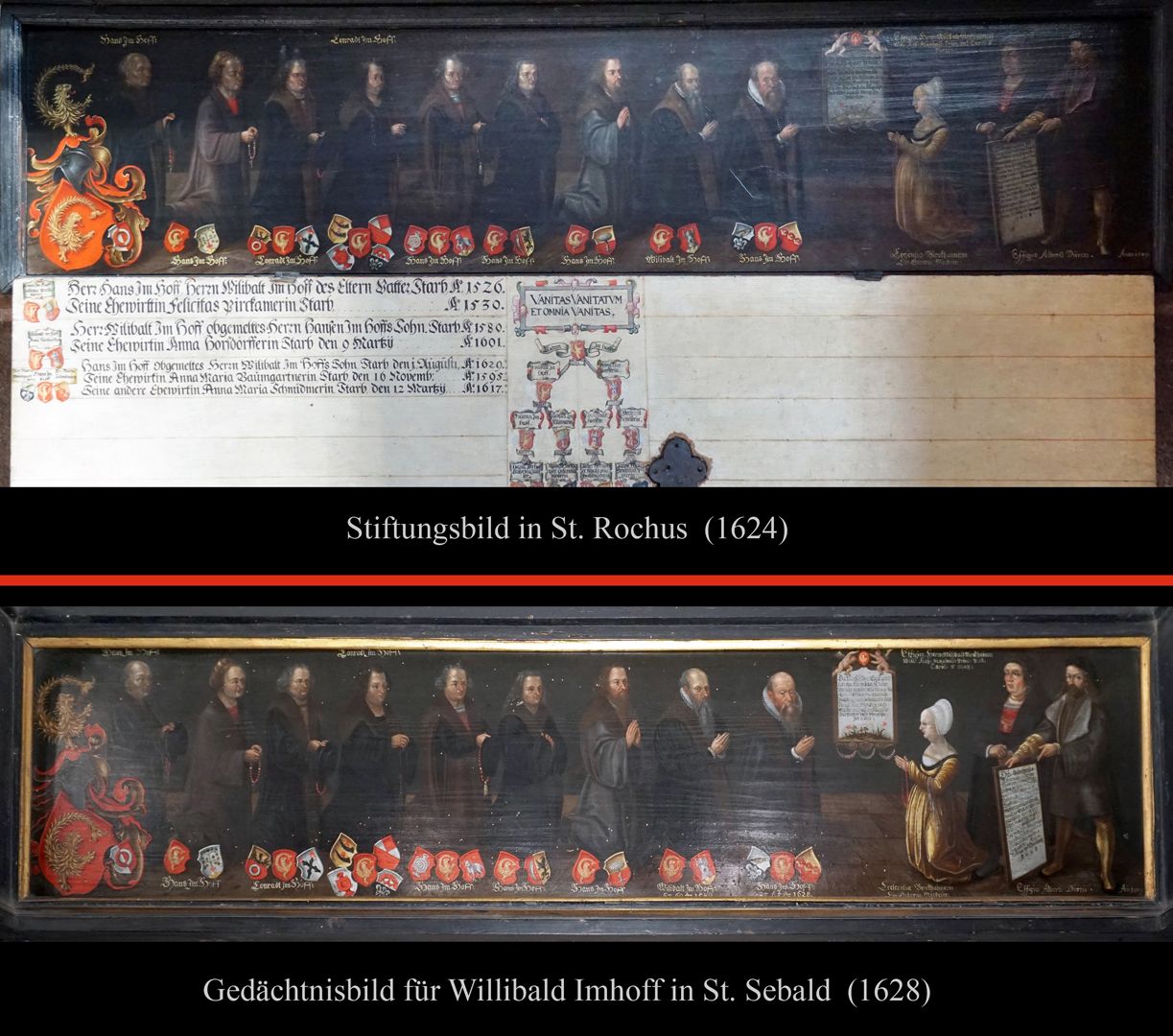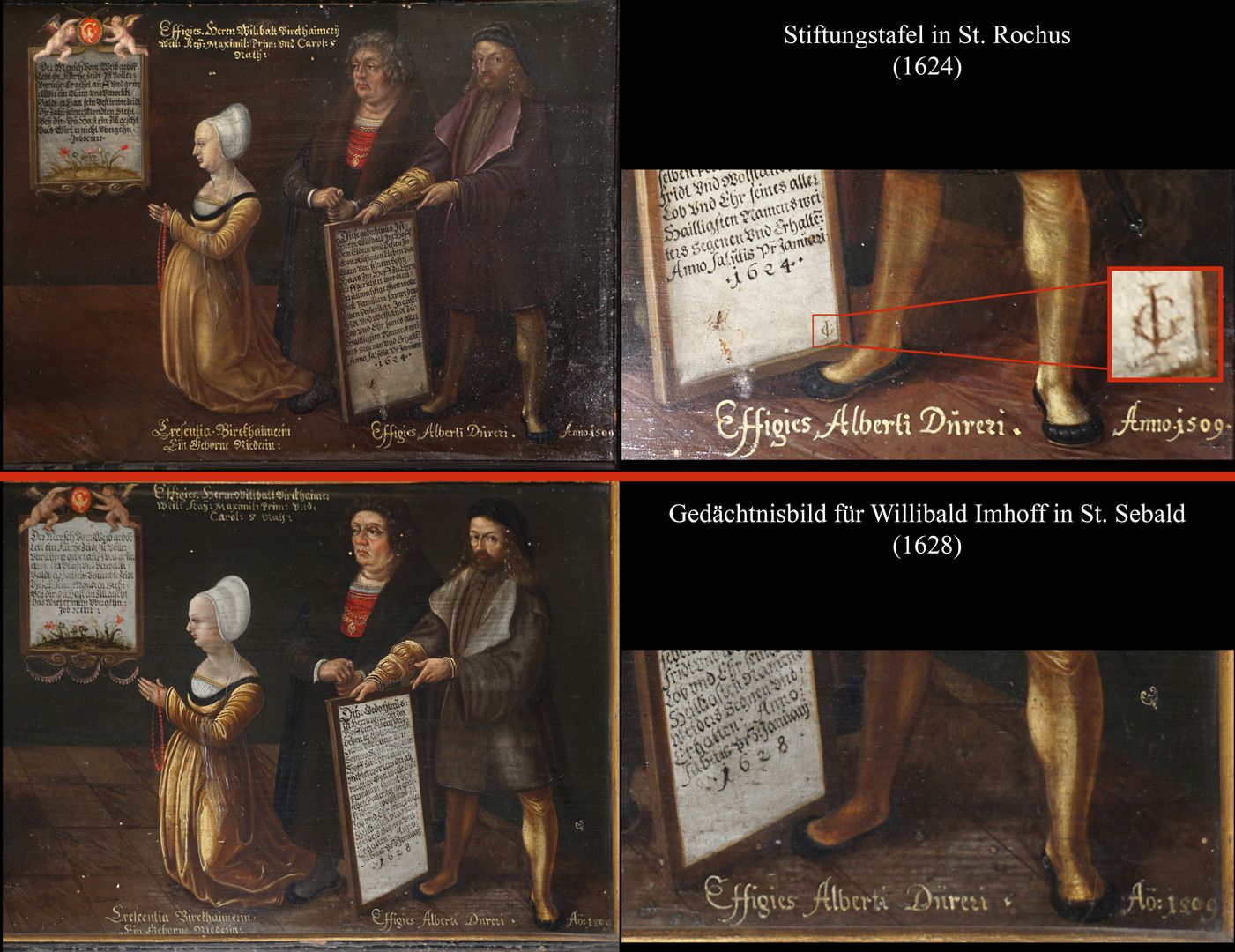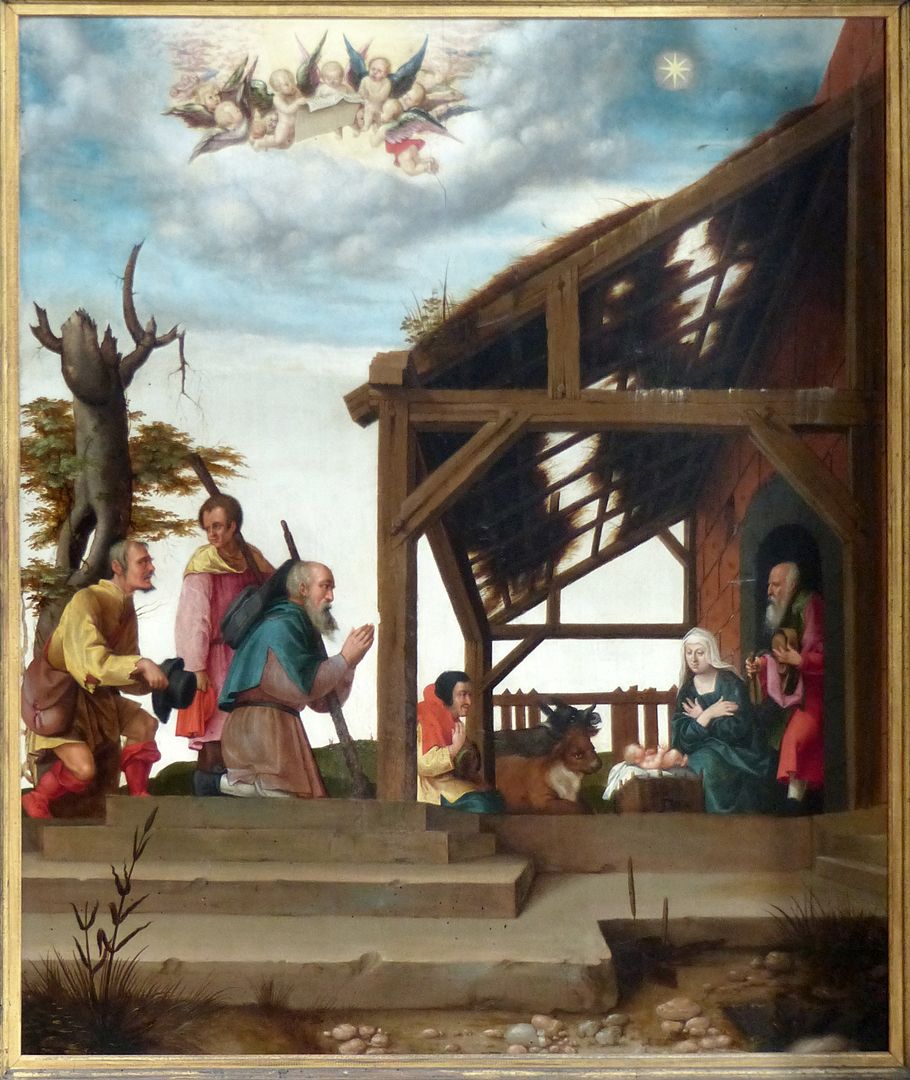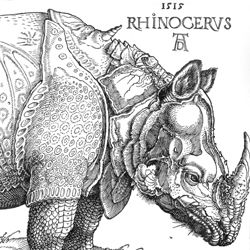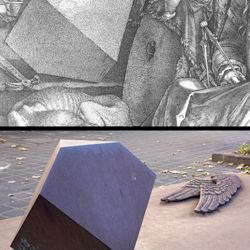Dürersche Stiftungstafel
Dürersche Stiftungstafel
1624
Blick in der Chor der Rochuskapelle, Stiftungstafel direkt nördlich vom Hauptaltar
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Geöffnete Stiftungstafel mit Flügeltür
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Geschlossene Stiftungstafel mit Flügeltür
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Conrad Imhoff
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Porträt des Kapellenstifters Conrad Imhoff
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Vergleichsbild oben: Conrat Imhof von Jakob Elsner, Nürnberg, 1486 (München, Bayerisches Nationalmuseum Inventarnr.: MA.310)
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: München, Bayerisches Nationalmusem / Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Porträt des Kapellenstifters Conrad Imhoff, Detailansicht
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
„Gnadenstuhl“
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
„Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend.
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2023, Pablo de la Riestra, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
„Gnadenstuhl“ und Inschrift
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
„Gnadenstuhl“, Detail, Putti mit Dornenkrone
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
„Gnadenstuhl“, Detailansicht
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer ist hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden.
Foto 2023, Theo Noll
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Dürersche Stiftungstafel
1624
Detailansicht der Gesichter von Christus und Gottvater
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Arme und Hände des totenbleichen Christus mit der linken Hand Gottvaters
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Die linke Hand Gottvaters zeigt die Wunde Christi
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
seitliche Kartuschen: links Hans Imhoff (1563-1629) / rechts seine beiden Frauen Anna Maria, geb. Paumgartner und Anna Maria, geb. Schmidmayer
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2023, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
untere Inschriftentafel mit Medaillon der Muttergottes und Kind, darunter Kartusche mit zwei Putti als Tod und Schlaf.
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Medaillon der Muttergottes mit Kind
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Vergleichsbild mit zwei Putti: oben Detail der Gedächtnistafel für Willibald Imhoff in St. Sebald / unten Detail mit bemalter Kartusche aus der sog. Dürerschen Gedächtnistafel in der Rochuskapelle
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
untere Inschriftentafel, aufgeklappt
Foto 2023, Theo Noll
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Dürersche Stiftungstafel
1624
Bildvergleiche
Foto 2023, Theo Noll
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle und St. Sebald
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Dürersche Stiftungstafel
1624
Bildvergleich
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle und St. Sebald
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2023, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
geöffneter Zustand
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle und St. Sebald
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2023, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
geöffneter Zustand
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten.
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten. (unten rechts Signatur AD !)
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Innenseite der Klapptafel, Detailansicht
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Anbetung des Christuskindes durch die Hirten
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Anbetung des Christuskindes durch die Hirten und obere Inschrift
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Dürersche Stiftungstafel
1624
Anbetung des Christuskindes durch die Hirten
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Vergleichsbild: Dürer, Die Kleine Passion, 1509 - 1511, Jesu Geburt
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll
Dürersche Stiftungstafel
1624
Vergleichsbilder, Details aus: Dürer, Die Kleine Passion, 1509 - 1511, Jesu Geburt
Im Chor direkt nördlich vom Hauptaltar hängt die sogenannte Imhoffsche oder Dürersche Stiftungstafel von 1624. Es handelt sich um einen flachen „Schrank“ mit einer Klapptafel.
Lange Zeit galt das Werk als die Berühmtheit der Kapelle schlechthin, weil es angeblich zwei Bilder von Dürer enthielt – selbst Goethe hat 1797 diese bewundert, ohne zu wissen, dass es sich um Kopien handelte. Aber es kommt noch schwerwiegender: Nicht einmal diese Eigenschaft als „Kopien“ lässt sich heute belegen.
Das Objekt ist zugleich Epitaph für den Kunstsammler Hans VII. Imhoff, seinen Vater Willibald I. und seine Vorfahren Imhoff und Pirckheimer. Georg Gärtner d.J. war hier der Maler. Die feste Rückwand zeigt eine Anbetung des Christuskindes durch die Hirten. Die Innenseite der Klapptafel stellt den 1504 erfolgten Tod der Creszentia Pirckheimer dar, Frau des berühmten Humanisten, diesmal mit dem genannten Todesjahr und wiederum dem Dürerschen Monogramm versehen, obwohl der große Meister hier nichts zu suchen hatte.
Im geschlossenen Zustand sieht man das vielleicht interessanteste der drei Gemälde: einen „Gnadenstuhl“, der letztlich auf den gleichlautenden Holzschnitt Dürers von 1511 zurückgehen soll, ihn frei paraphrasierend. Ikonographisch fällt auf, dass die päpstliche Tiara Gottes bei Dürer hier sicherlich konfessionsbedingt zu einer Kaiserkrone geworden ist. Ferner ist wenig Übereinstimmung mit dem Vorbild festzustellen, als Ganzes und im Detail, geschweige denn der Malstil. Über dem Flachschrank steht eine ädikulaartige Tafel mit dem Porträt des Kapellenstifters Konrad Imhoff, so wie wir ihn von der Darstellung auf dem 1486 datierten Triptychon von Jakob Elsner kennen (heute im Bayerischen Nationalmuseum in München), also die Kopie eines spätgotischen Werks.
(Pablo de la Riestra)
Rochuskapelle Nürnberg, 32 Seiten, 66 Abb., Format 13,6 x 19 cm, 1. Auflage 2021,
Kunstverlag Josef Fink / ISBN 978-3-95976-339-4
Standort: Nürnberg, Rochuskapelle
Entwurf: Dürer, Rezeption, Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J.
Foto 2021, Theo Noll