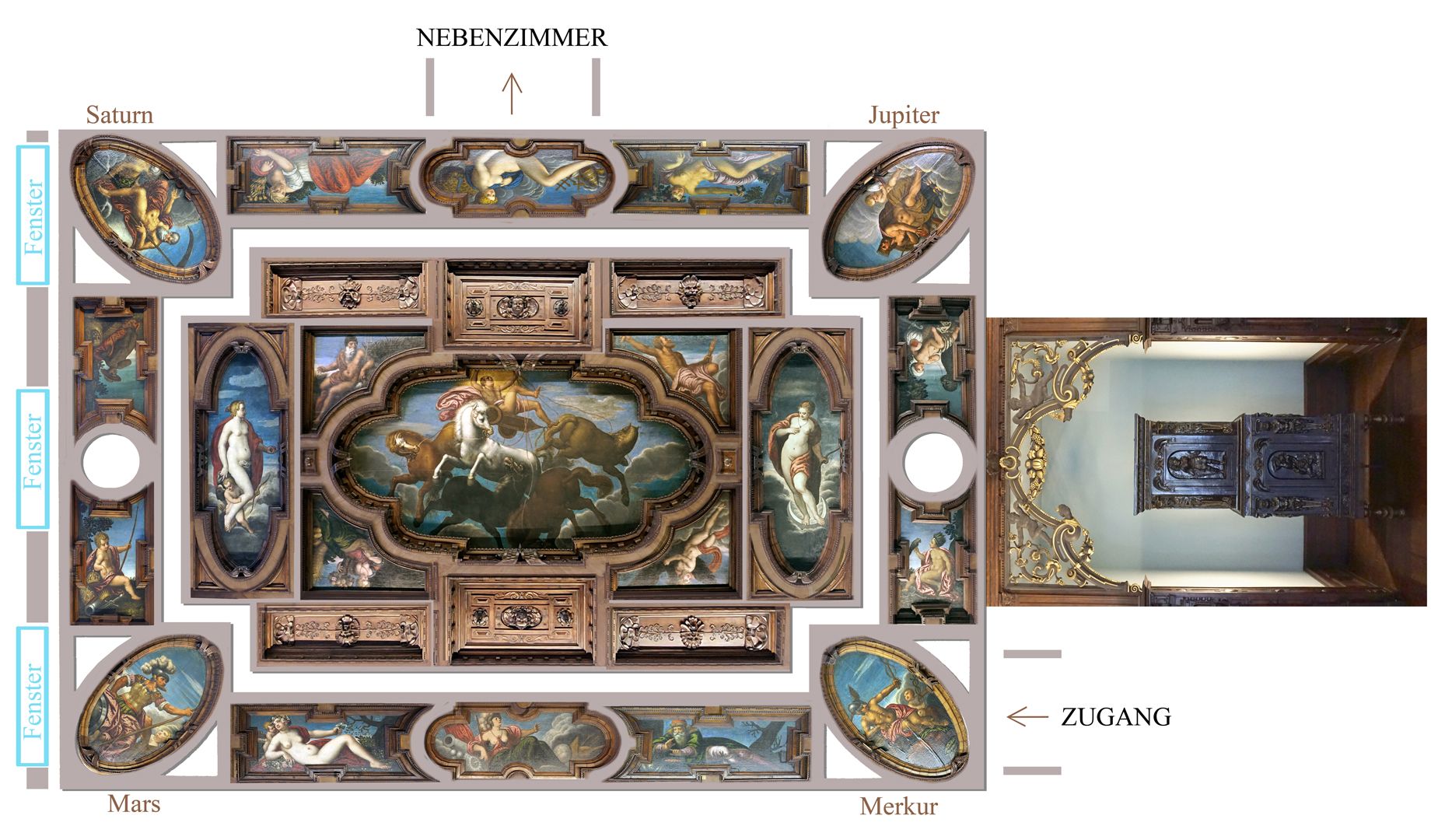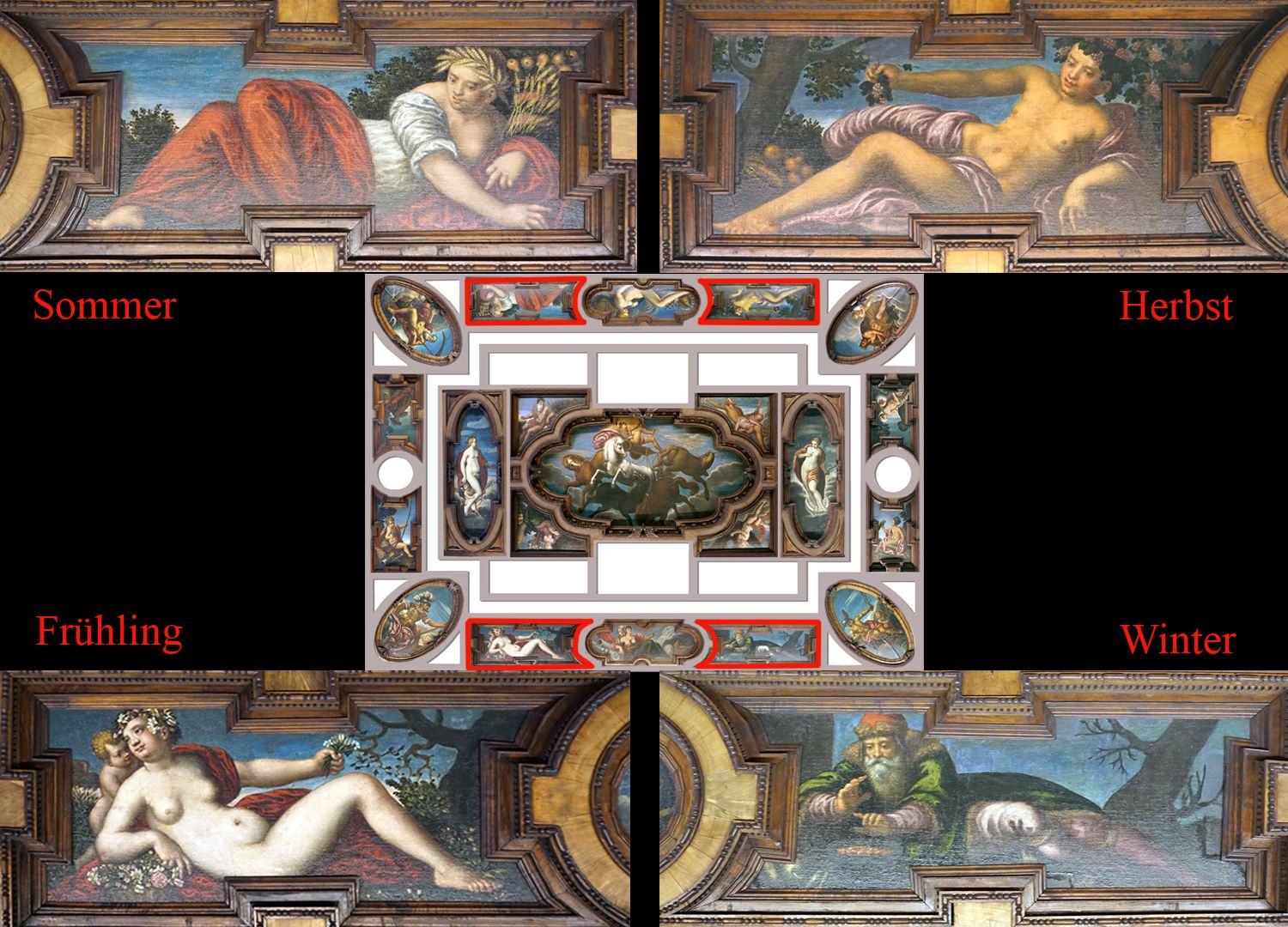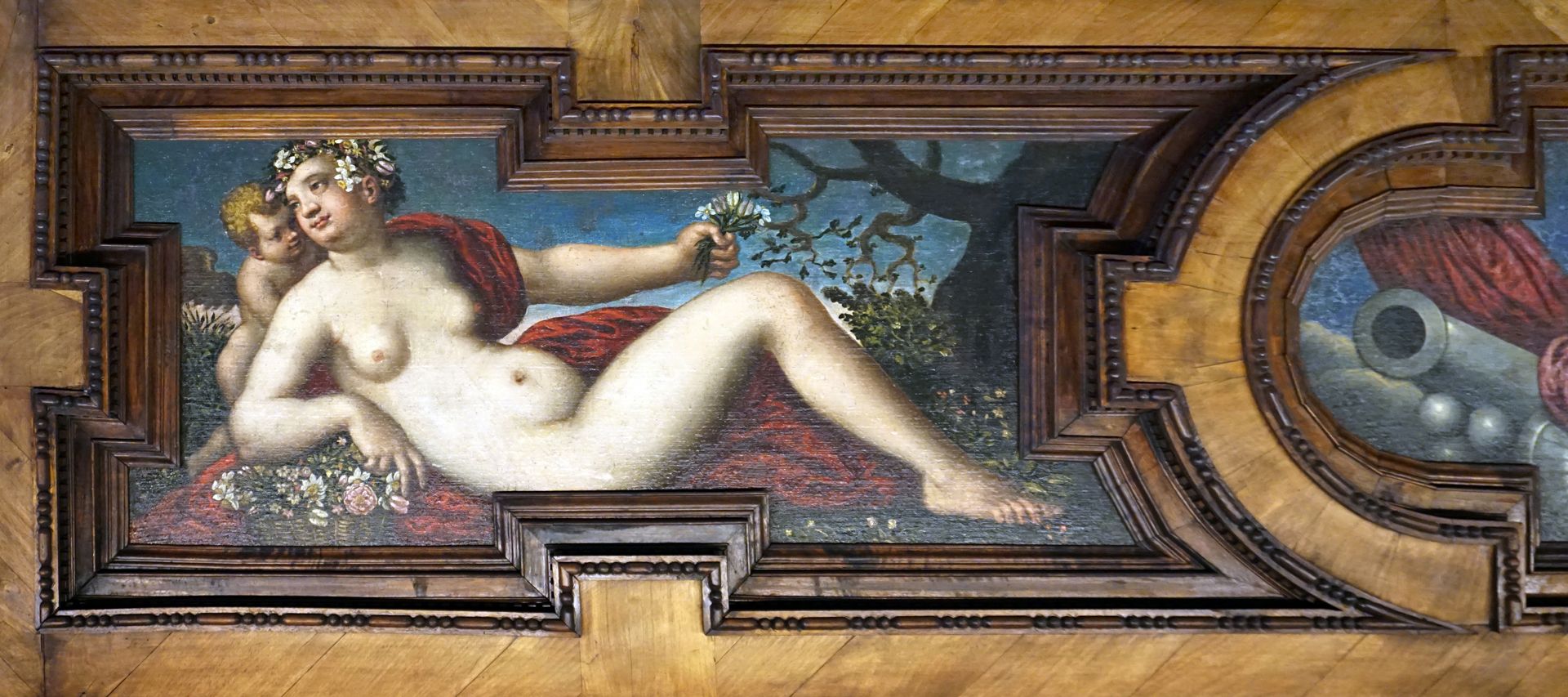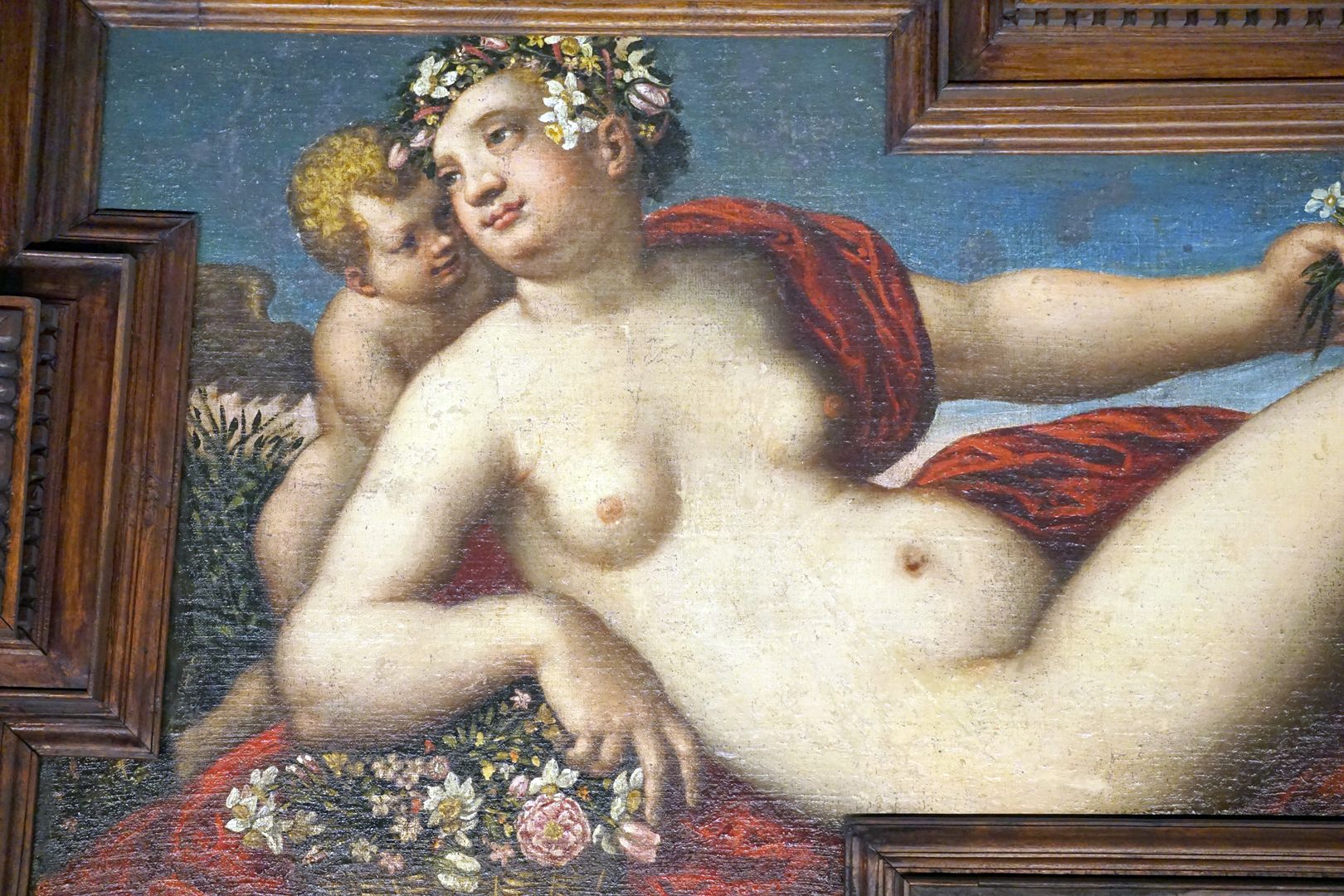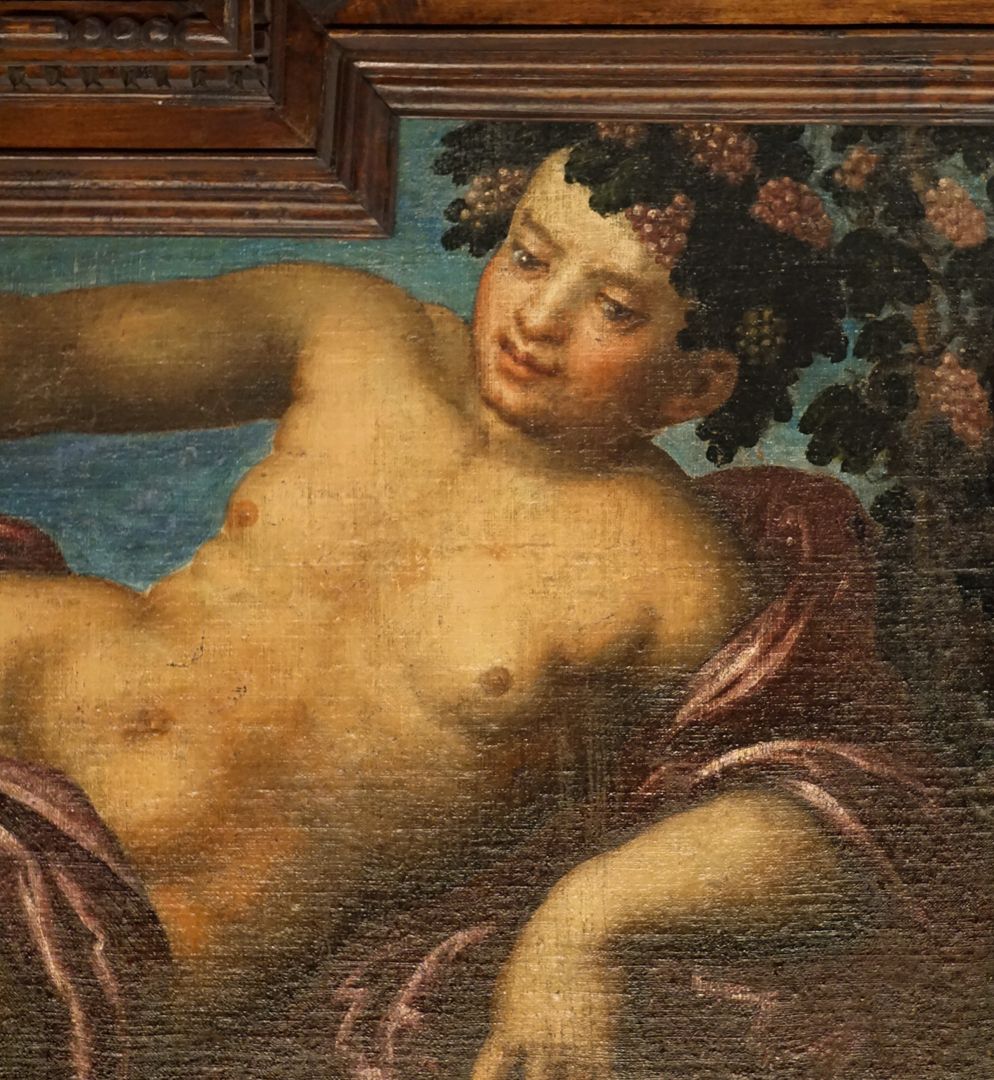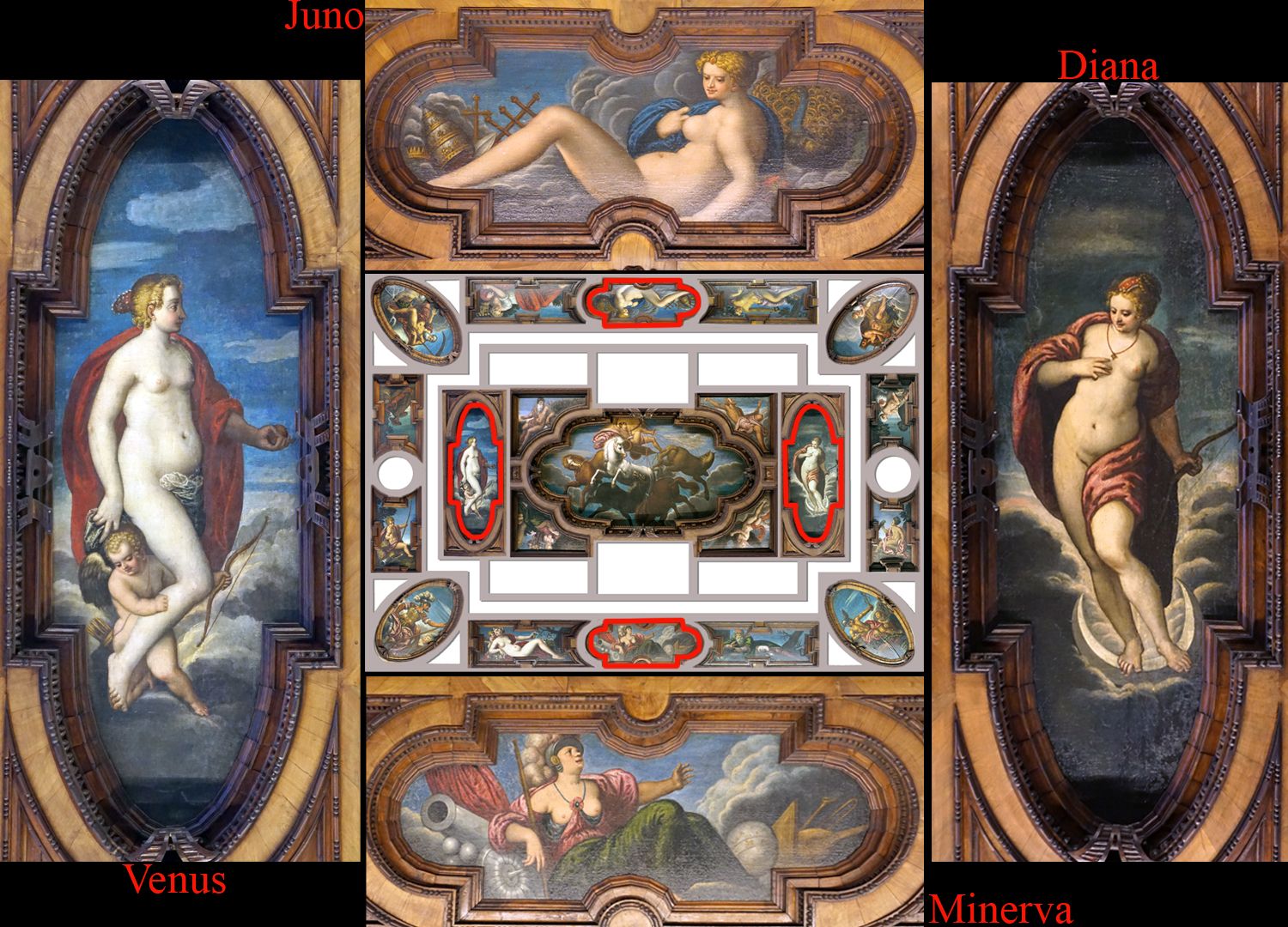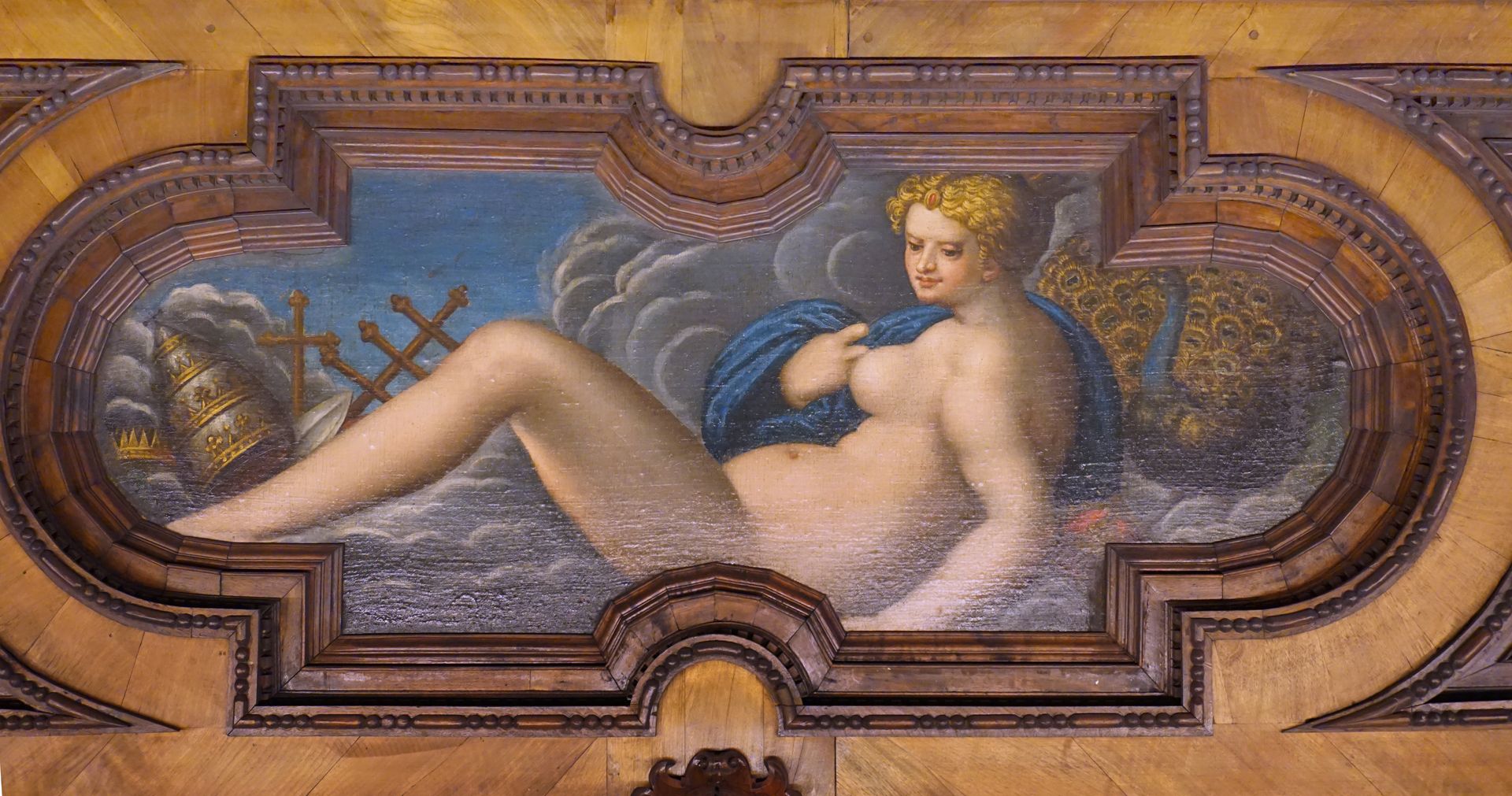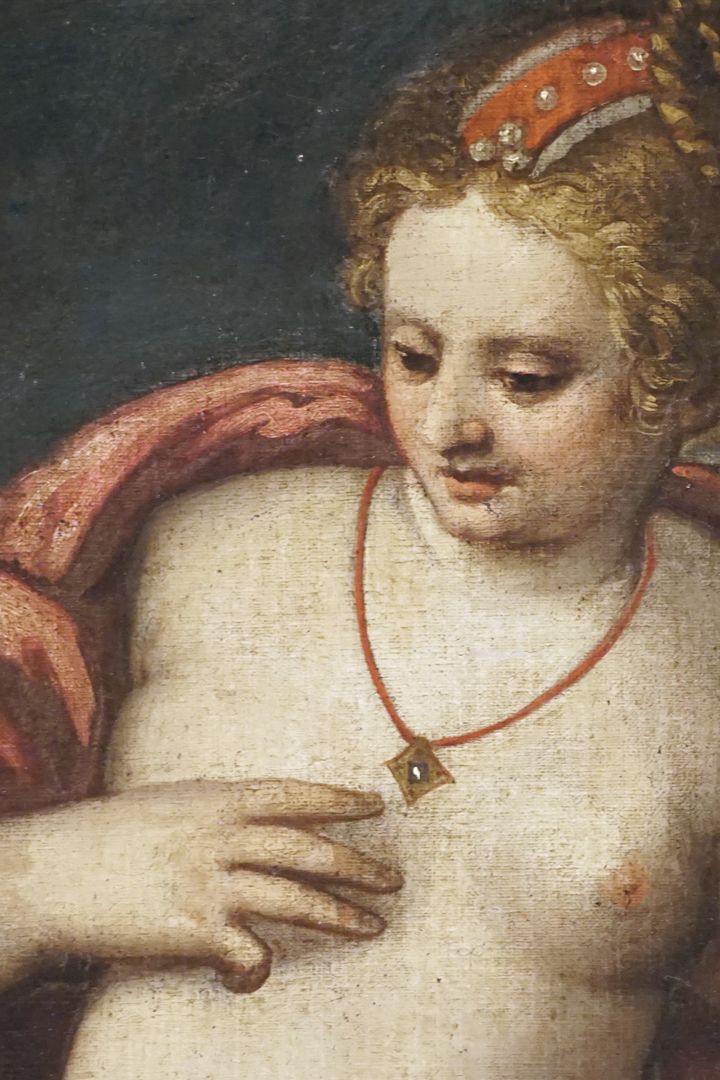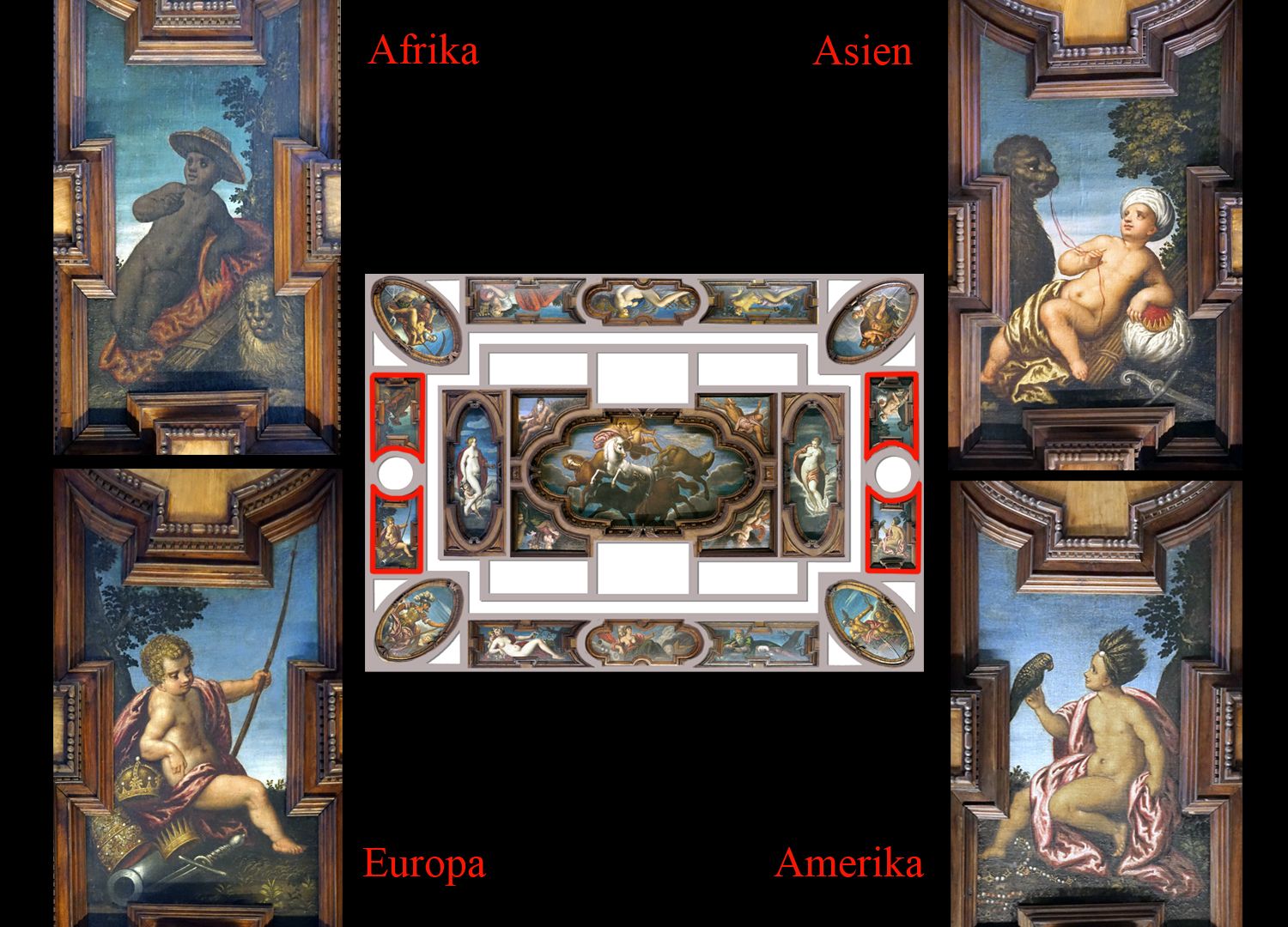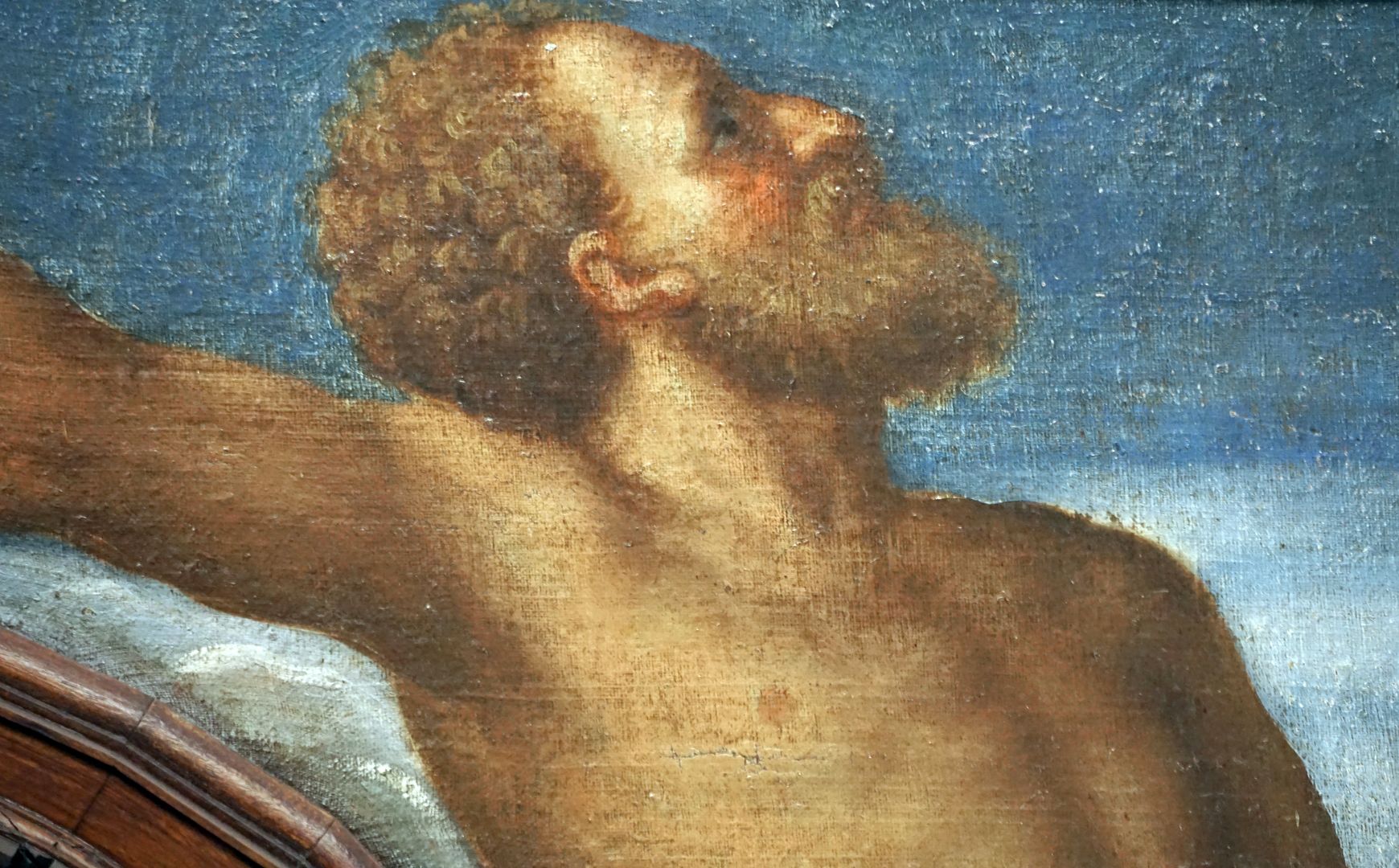Decke des Schönen Zimmers
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Schrägansicht in Richtung Fenster
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Pablo de la Riestra
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Deckenansicht, Ausschnitt
Foto 2023, Pablo de la Riestra
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Deckenfelder mit Gemälden, links die Fenster, rechts die Ofennische
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Götter
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Saturn (Gott der Erde, der den Menschen Wohlstand und Reichtum bringt. Sein Attribut ist die Sense)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Saturn, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Jupiter (Herrscher aller Götter, Herr des Himmels. Seine Attribute sind das Zepter, das Blitzbündel und der Adler)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Jupiter, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Jupiter, Detailansicht, Putto mit einem Bischofshut
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Mars (Gott des Krieges. Bekleidet mit einer Rüstung und einem Federbuschhelm)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Mars, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Merkur (Der Götterbote, Gott des Handels, Gewerbe und Verkehrs, Patron der Reisenden und Wanderer, Beschützer der Kaufleute. Bekleidet mit einem Flügelhelm. In seiner Rechten sein Attribut, der Caduceus-Stab)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Merkur, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Merkur, Detailansicht, Putto mit einem Caduceus-Stab
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Jahreszeiten
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Frühling (Flora, die Blühende. Geschmückt mit Blumenkränzen und von einem Putto begleitet)
Foto 2023, Theo Noll
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Frühling, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Frühling, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Sommer (Ceres, Göttin der Erde und Beschützerin des Ackerbaus)
Foto 2023, Theo Noll
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Sommer, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Herbst (Bacchus, Gott des Weines)
Foto 2023, Theo Noll
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Herbst (Bacchus, Gott des Weines), Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Winter (Boreas, Gott des Nordwindes, ein bärtiger alter Mann, der sich an einem offenen Feuer wärmt)
Foto 2023, Theo Noll
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Winter, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Göttinnen
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Venus (Göttin der Liebe, der Schönheit und der Fruchtbarkeit, zusammen mit ihrem Sohn Amor, dem Liebesgott, einem geflügelten Knaben mit Bogen und Köcher)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Venus, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Venus, Detailansicht mit Amor
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Juno (Göttin der Ehe, Beschützerin der Frauen und der Familie. Dargestellt mit Herrschaftssymbolen und ihrem heiligen Vogel, dem Pfau)
Foto 2023, Theo Noll
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Juno (Göttin der Ehe, Beschützerin der Frauen und der Familie. Dargestellt mit Herrschaftssymbolen und ihrem heiligen Vogel, dem Pfau), Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Minerva (Göttin des Krieges, Beschützerin der Künste und Wissenschaften, Patronin des Wissens und der Tugend. Bekleidet mit einem Gewand und Federbuschhelm, umgeben von ihren Attributen: Kanone, Kanonenkugel, Schild, Globus und Musikinstrumenten)
Foto 2023, Theo Noll
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Minerva, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Minerva, Detailansicht mit Sternzeichen-Globus, Winkel und Musikinstrumenten
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Diana (Göttin der Jagd und der Natur, Fruchtbarkeitsgöttin und Mondgöttin. Dargestellt mit einem Bogen in der Rechten, auf einer Mondsichel stehend)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Diana, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Kontinente
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Afrika (Knabe mit einem Löwen)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Afrika, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Europa (Knabe mit Bogen in der Hand. Zu seinen Füßen Kronen und Kriegsgerät)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Europa, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Amerika (Knabe mit Federkopfschmuck und einem Papagei in der Hand)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Amerika (Knabe mit Federkopfschmuck und einem Papagei in der Hand), Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Asien (Knabe mit einem Turban bekleidet, begleitet von einem Sklaven?)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Elemente
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Wasser (Neptun, Meeresgott, mit seinem Attribut, dem Dreizack)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Feuer (Wohl Prometheus mit Blitzbündel und Fackel, der den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen schenkte)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Prometheus, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Erde (Kybele, die Magna Mater, Mutter der Götter, mit einem Füllhorn mit Blumen und einer Sichel in den Händen)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Kybele, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Luft (Ganymed, Sohn des trojanischen Königspaares, entfacht durch seine Schönheit die Liebe Jupiters. In Form eines Adlers entführt er den Jungen in den Olymp, wo er anstelle der Hebe Mundschenk der Götter wird)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Ganymed mit dem Adler, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton (Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung vor menschlichem Übermut)
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Sturz des Phaeton, Schrägansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Sturz des Phaeton, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll
Decke des Schönen Zimmers
1609 1610
Sturz des Phaeton, Detailansicht
Zentrales Deckengemälde: Sturz des Phaeton
Der Sohn des Sonnengottes Helios wollte dessen Sonnenwagen lenken, stürzte jedoch vom Himmel und verbrannte die Erde. Er wurde daraufhin von Jupiter mit einem Blitz erschlagen. Der Sturz des Phaeton ist ein Sinnbild der Selbsterkenntnis und eine Warnung von menschlichem Übermut.
(Infotafel, Stadtmuseum im Fembohaus)
________________________________
(siehe auch: Pellerhaus )
________________________________
Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus
(Dieter Büchner)
Die Entstehung der Deckenbilder:
Im Verrechnungsbuch Martin Pellers sind neben dem Eintrag für die Schnitzerei der „Ofennische“ weitere sieben Bezahlungen von Malern verzeichnet:
1609:
Ad 28 dito [Januar] zaltt dem Görg Gerttner für zwen drackhenköpff zu mallen und 2 verffen 20,10,-
1610:
13 dito [September] An gmein Cassirer dem Maller und Schrein. 89.10.-
22 dito [Dezember] An Cassa dem Jerg Gertner Maller 81.4.-
1611:
19 dito [Juli] An Cassa dem Jungen Gertner Maller 16.10.-
12 Augusti An Cassa dem Jerg Gertner Maller 8.12.8
1614:
9. dito [November] zalt dem Johann Kreuzfelder Mahler, von seines herrn Schweher, auch sein L. hausfraw [Pellers Schwiegervater Bartholomäus Viatis und seine zweite Ehefrau Florentina, geb. Jäger] Conterfet zuverfertigen, zusamen 24.-.-
1615:
10 dito [Oktober] dem Linhart Prechtel Maller laut auszuegs 12.-
Keiner dieser Einträge kann unmittelbar als Entlohnung für die Deckenbilder des „Schönen Zimmers“ bestimmt werden. Auf Anhieb sind jedoch die beiden letzten auszuschließen: So erfolgte die Bezahlung von Johann Kreuzfelder (gest. 1636) am 9. November 1614 für zwei Portraits und der an Linhart Prechtel, d.h. Leonhard Brechtel d.Ä. (von 1598 – 1622 nachweisbar) gegangene Betrag von 12 Gulden ist viel zu gering für 21 Leinwandbilder1.
Von den namentlich genannten Malern bleibt demnach nur Georg (Jerg/Görg) Gärtner übrig. Zur fraglichen Zeit lebten in Nürnberg zwei Maler dieses Namens, nämlich Georg Gärtner d.Ä. und dessen Sohn. Zwar wird Gärtner im Eintrag vom 19. Juli 1611 ausdrücklich als der „junge“ Gärtner bezeichnet, da die anderen Verbuchungen jedoch nicht spezifiziert sind, können sie sich ebensogut auf Georg Gärtner d.Ä. beziehen. Beide kommen von ihren Lebensdaten her in Frage. Der ältere Gärtner, der im Jahre 1574 anlässlich seiner Heirat erstmals erwähnt wurde, hielt spätestens ab 1580 Lehrlinge, war zu diesem Zeitpunkt also Meister, und wurde am 22. Januar 1612 beerdigt2. Vom jüngeren Gärtner (gest. 1654) ist zwar weder das Geburtsjahr noch das Erwerbsdatum des Meisterrechts bekannt3, doch muss er dieses schon lange vor der ersten Eintragung im Verrechnungsbuch besessen haben.
(S. 131 – 133)
(...)
Dennoch soll im folgenden nur von Gärtner dem Jüngeren bzw. allgemein von der Gärtner-Werkstatt die Rede sein. Eine strikte Unterscheidung ist schon deshalb nicht sinnvoll, weil Vater und Sohn archivalischen Hinweisen zufolge eine gemeinsame Werkstatt betrieben zu haben scheinen4 und ihr Werk auch stilistisch noch nicht klar voneinander getrennt werden konnten5.
(S. 134)
(...)
Unter der Voraussetzung, dass die beiden Gärtner eine gemeinsame Werkstatt unterhielten, beschäftigten sie von 1592 bis mindestens 1609 ständig wenigstens einen und meist sogar zwei Lehrlinge. Demnach ist anzunehmen, dass die Gärtner-Werkstatt in eben diesen Zeitraum, in dem auch die Deckengemälde des Pellerhauses hergestellt wurden, in ihrer Hochblüte stand.
(S. 156)
(...)
Mit insgesamt sieben verbürgten Lehrlingen hatte der jüngerer Gärtner die meisten Schüler unter allen Nürnberger Malern des frühen 17. Jahrhunderts.
(S.157)
(...)
Mit einer Autorenschaft Gärtners würden sich schließlich auch einige der Besonderheiten erklären lassen, welche an den Deckenbildern des „Schönen Zimmers“ auffielen. So wäre mit der Ausführung durch einen italienunkundigen, jedoch augenscheinlich anpassungsfähigen Maler das überdeutliche Bemühen um eine venezianischen Charakter der Deckenbilder zu begründen. Dessen mangelnde Erfahrung in der Darstellung mythologischer Themen mag zu der ungewöhnlichen Fünfzahl der Pferde beim Phaetonsturz beigetragen haben. Weiter stimmt die geringe Kenntnis in profaner Ikonographie mit der vornehmlichen Tätigkeit Gärtners als Dürernachahmer überein. Dieses wiederum erklärt die bei der Venusdarstellung festgestellte Übernahme von motivischen Elementen der Dürerzeit.
(S. 166)
____________
1 Zu Brechtel: Bösche, 1899, S. 128-129. - Theodor Hampe, Art. "Brechtel", in: Thieme /Becker, Bd. 4, 1910, S.560
2 Die Beschäftigung eines Lehrlings geht aus einem Ratsverlaß des Jahres 1580 hervor. Ratsverlässe, 1580, IV, fol. 32r-32v. Nach: Hampe, 1904 (Ratsverlässe), S.73, Nr. 472. Allgemein zu Gärtner d.Ä.: Doppelmayr, 1730, S. 222. - Georg Kaspar Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexicon ...; München 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Georg Kaspar Nagler, Die Monogrammisten ...; 5 Bde., München 1858-1879, bd. 2, 1860, S.1084, Nr. 3110. - Lochner, 1875, S. 198. - Bösch, 1899, S. 130-131. - Theodor Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44-45. - Barock in Nürnberg 1600-1750. Aus Anlaß der Dreihundertjahrfeier der Akademie der bildenden Künste, Nürnberg 1962, S. 44 (Peter Strieder). - Baumgartl/Lauterbach/Otto , 1993, S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.Ä. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 292-294).
3 Zu Gärtner d.J.: Doppelmayr, 1730, S. 225. - Nagler, 1835-1852, Bd. 4, 1837, S. 549. - Rettberg, 1854, S. 188. - Nagler, 1858- 1879, Bd. 2, 1860, S. 1049, Nr. 2999 und S. 1056, Nr. 3023, Bd. 3, 1863, S. 1, Nr. 2. - Andreas Andresen, Der deutsche peintre graveur ..., 5 Bd., Leipzig 1864-1878, Bd. 4, S. 270- 277. - Lochner, 1875, S. 198. - Ernst Guhl, Künstlerbriefe, Berlin 1879, S. 351. - Bösch, 1899, S. 130- 131. - Theodor Hampe, in Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44- 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Peter Strieder), S. 98 und S. 101 (Elisabeth Rücker). - Heinrich Geissler, Zeichnungen in Deutschland. Deutsche Zeichner 1540- 1640, Stuttgart 1979, S. 218- 219. - Gisela Goldberg, Jörg Gärtner, in: berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten, hrsg. von Christoph von Imhoff, Nürnberg 1989, S. 163- 164. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993. S. 158-159. Näheres zum Leben Georg Gärtners d.J. im Kapitel II des Anhangs (in: Das "Schöne Zimmer" aus dem Pellerhaus, Dieter Büchner, 1995, S. 294- 298).
4 Dies ist aus den Angaben ihrer Wohnsitze zu schließen. Der Erbar uns Kunstreich Georg Gertner der Elter wurde zum Zeitpunkt seines Todes am 22. Januar 1612 als flachmaler am Schwabenberg im Kappenzipffel bezeichnet. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607- 1623, fol.86. Für die nur einige Wochen zuvor, am 31. Dezember 1611, verstorbene Frau Gärtners d. J. wird im Sterbemartikel derselbe Wohnort genannt: frau Magdalena des kunstreichen Georg Gärtners des jüngeren flachmalers Ehewirthin am Schwabenberg im Kappenzipffel. LKAN Totenbücher St. Sebald 1607-1623, fol. 85. Die Einträge in den Sterbematrikeln wurden mit geringfügig abweichender Diktion und heute nicht mehr zutreffenden Quellennachweis bereits erwähnt von. Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 44. Von einer gemeinsamen Werkstatt geht auch aus: Goldberg, 1989, S. 164.
5 Hampe, in: Thieme/Becker, Bd. 13, 1920, S. 45. - Barock in Nürnberg, 1962, S. 44 (Strieder). - Geissler, 1979, Bd. 1, S. 218. - Baumgartl/Lauterbach/Otto, 1993, S. 158.
zitiert aus:
Dieter Büchner: Das „Schöne Zimmer“ aus dem Pellerhaus. Ein bürgerlicher Repräsentationsraum im Nürnberg des frühen 17. Jahrhunderts, Schriftreihe des Stadtarchivs Nürnberg, 1995
Standort: Nürnberg, Stadtmuseum Fembohaus (ehemaliger Standort war im Pellerhaus am Egidienberg)
Entwurf: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Umsetzung: Gärtner (Gertner, Hortulanus), Georg (Jörg) d. J., Gärtner, Georg (Jörg) d. Ä.
Foto 2023, Theo Noll