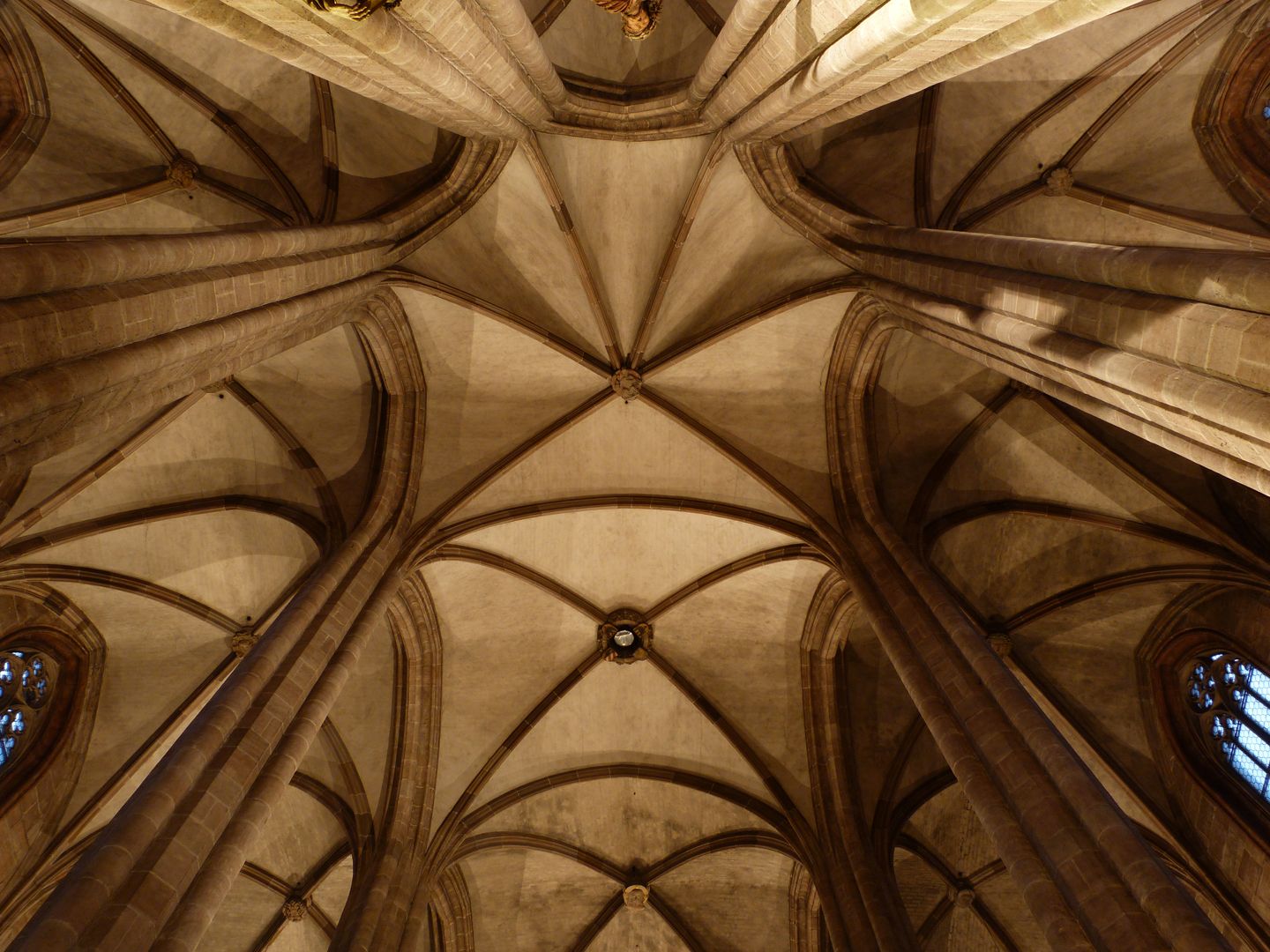Die Sebalduskirche als Architektur
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
St. Sebald im Stadtbild von N
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2012, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
St. Sebald im Stadtbild von O (Im Vordergrund der Laufer Schlafgturm)
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2015, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
St. Sebald von SW: Westchor, Turmpaar, basilikales Langhaus mit romanischem Obergaden, Hallenchor.
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2015, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
St. Sebald von NW
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 24. Mrz 2022, Elmar Arnhold
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Baukörper von SW: Der Westchor dreigeschossig, Beinhaus, Peters-, Engelschor. Die romanischen Fenster vom ehemaliges Querhaus als Westwand des Chores zu sehen.
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2009, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Westchor, sogenannter Engels- oder Michaelschor mit Emporenkanzel
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2015, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Inneres des Engelchores
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Wölbung des Peterchores als frühgotischer 5/8 Schluss und Vorjoch mit sechsteiligem Gewölbe
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Hochgotischer Aufriss des Langhauses mit Pseudotriforium, Obergaden und Kreuzrippengewölbe
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2010, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Hochgotischer Aufriss: Arkade, Pseudotriforium und Obergaden
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2020, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Detail des Triforiums (östliches Südjoch, hier als Blende gestaltet)
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Schrägansicht vom südlichen Seitenschiff in Richtung NO
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2020, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Blick in das Nordschiff vom Schatzkammerchörlein aus
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Blick auf Langhaus vom Engelschor aus
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Panoramablick von W nach O
Foto 2022, Thomas Noll
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Einmündung des Langhauses in den Hallenchor (vormaliges Querhaus)
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Frühgotische Knospenkapitelle
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2013, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Frühgotische Knospenkapitelle
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2012, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Baukörper von N: von r. Nach l.: Westchor, Türme, Langhaus mit Marienportal, ehemaligen Querhaus (Chor) mit Brautportal, Chor mit Sakristei (deren Obergeschoss Schatzkammer)
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2016, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Blick in den Hallenchor nach O
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Hallenchor von SO
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2011, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Hallenchor von SO
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2021, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Hallenchor von NO
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2021, Theo Noll
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Hohe vierteilige Chorfenster
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2011, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Chor von SW: die schmucklosen ersten zwei Joche entsprechen dem vormaligem Querhaus
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2010, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Reich gegliederte Chorpfeiler
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Abfolge der Blendwimperge als Oberteil der Chorstrebepfeiler
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2010, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Chornordseite: Transparenz der Glasfenster zwischen den Strebepfeilern
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2015, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Chor nach O
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2012, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Chorumgang mit abwechselnden recht- und dreieckigen Jochen mit jeweils Kreuzrippen und Dreistrahlen
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Theo Noll
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Chorumgang mit neun Seiten eines Sechzehnecks
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Theo Noll
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Schrägansicht des Hallenchores
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Innerer 5/8-Schluss des Hallenchores
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2019, Theo Noll
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
a: Vorkriegszustand b: bei der rekonstruierten Chorwölbung wurden die hängenden Maßwerkfriese unter den Rippen nicht wiederhergestellt, dies ändert die Atmosphäre gravierend. Zum etwaigen Vergleich: c: Ansbach St. Johannis und d: Quedlinburg St. Benedikti
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
FotoPablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Chörlein der ehemaligen Schatzkammer über der nördlichen Sakristei
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2009, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Untersicht des Chörleins
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2009, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Innenansicht des Chörleins
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Gratgewölbe des Chörleins
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 27. Apr 2022, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
nördliche Sakristei in Richtung Altar
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2022, Pablo de la Riestra, Theo Noll
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Marienportal
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Brautportal
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2017, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Brautportal mit durchbrochenem Maßwerk und hängendem Fries
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2016, Theo Noll
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Südturm, Wächterstube gegen eine Wolkenwand
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2014, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Nordturm: Wächterstube
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2018, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Südturm: Maßwerkbrüstung und Blendfries: bei dieser Arbeit ist die Beteiligung Adam Krafts überliefert
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2015, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Abschluss des Treppentürmchens zum maßwerkumzäunten Gang
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2011, Pablo de la Riestra
Die Sebalduskirche als Architektur
13. Jh. bis 15. Jh.
Umgang am Chordachfuss
Die Sebalduskirche in Nürnberg ist das Ergebnis von vier Bauabschnitten, der Instandsetzung um 1900 und der Behebung der 1944-45 erfolgten Kriegsschäden. Der mittelalterliche Bau prägt die Stadt mit ihrer kernigen Silhouette. Das Mittelalter hinterließ eine Gestalt, die aus einer ursprünglichen Basilika mit einem gewaltigen Hallenchor und der die Gewichtung der Bauvolumina wieder ins Lot bringenden Turmerhöhung besteht. Von der von außen in romanischer Formensprache beherrschten Basilika (ca. 1230/40 – 1273) sieht man nur noch den Obergaden vom Langhaus und vom (ehemaligen) Querhaus – ferner die unteren Geschosse des Turmpaares bzw. den dreigeschossigen Westchor. Diese Basilika ist im Inneren vollkommen frühgotisch und zwar in der „orthodoxen“ Form der französisch bestimmten Superposition von Arkaden, Triforium und Obergaden – auch wenn das „Triforium“ hier eher wie die Befensterung eines staufischen Palas aussieht. Aus der Hochgotik stammen Umbauten am Westchor und Türmen sowie an den Seitenschiffen (1. Hälfte des 14. Jh.). Während die Obergadenfenster keinerlei Einteilung kennen, prahlt jetzt der Umbau in reifen Maßwerkformen. Der künstlerische Höhepunkt gelang durch den hallenförmigen Chorbau in vollendeter Raumummantelung des Binnenchores 1361-79 unter einem kolossalen, einheitlichen Dach – ein Meisterwerk der Parler, jene Baumeisterfamilie aus Köln bzw. Schwäbisch Gmünd, die den Veitsdom in Prag schuf. Dieser Chor, dessen Strebepfeiler ungemein reich gegliedert sind, lässt sich als „Parlerische Chorfassade“ bezeichnen, auch wenn hier Fassade etwas ganz anderes, als was man in Italien meinte. Da die Kirche durch den Westchor „bipolar“ wurde, konnte eine konventionelle Hauptschauseite mit großen Portalen gemieden werden. Der reichste Bereich von St. Sebald steht bezeichnenderweise vis-à-vis vom Rathaus und macht dessen Status als „Ratskirche“ anschaulich. Die Türmerstuben und Turmhelme kamen in den 1480er Jahren dazu, der südliche Helm mit Schallöffnungen für kleine Glocken sorgt für etwas Asymmetrie. In seinen Bauabschnitten tritt Sankt Lorenz bei allen Unterschieden in die Fußspuren von Sankt Sebald.
Dr. Pablo de la Riestra, 2022
siehe auch: Die Lorenzkirche als Architektur
Standort: Nürnberg
Foto 2012, Pablo de la Riestra